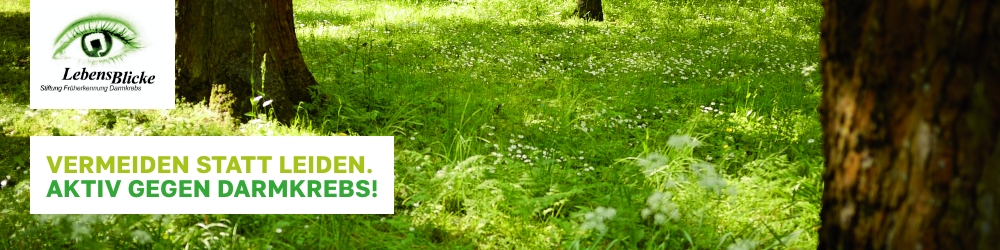Vom 17.-20. September fand in Leipzig die Viszeralmedizin 2025 statt. Die folgende Auswahl an Abstracts zeigt aktuelle Trends in der Früherkennung und Therapie des Kolonkarzinoms. • Früh auftretendes Kolorektales Karzinom (eoCRC): In einer großen Freiburger Kohorte traten eoCRC-Fälle häufiger in fortgeschrittenen Stadien auf (Stadium III/IV: 70% vs. 40% bei eoCRC) und zeigten öfter Mikrosatelliteninstabilität (MSI) (20% vs. 11%). Auffällig: eoCRC-Patientinnen und Patienten hatten niedrigeren BMI und seltener Diabetes/Adipositas – Warnzeichen bei Jüngeren sollten daher unabhängig von klassischen metabolischen Risikofaktoren ernst genommen werden. (Hilbert J; doi: 10.1055/s-0045-1810929) • Adjuvante Chemotherapie ab 75 Jahren (UICC III): Registerdaten über 41.630 Fälle zeigen einen klaren Überlebensvorteil: 5-Jahres-OS 62,0% mit vs. 41,8% ohne adjuvante Chemotherapie (HR 0,677). Dennoch erhielten nur 28,2% der ≥ 75-Jährigen eine adjuvante Therapie. Konsequenz: keine pauschalen Ausschlüsse, sondern differenzierte Aufklärung und individuelle Entscheidung. (Langheinrich M; doi: 10.1055/s-0045-1810924)
• Neoadjuvante Checkpoint-Inhibition bei MMRd/MSI-H-Kolonkarzinomen: In einem Real-World-Kollektiv (n = 7) führte eine kurze duale Immuntherapie (Nivolumab/Ipilimumab) bei allen zu pathologischer Komplettremission (ypT0 N0); bislang kein Rezidiv in der Nachsorge. Perspektive: Die neoadjuvante Checkpoint-Inhibition erscheint als zukünftig vielversprechende Therapieoption; hierfür sollte der MSI/MMR-Status gezielt bestimmt und der Einsatz außerhalb von Studien sorgfältig geprüft werden. (Decker A; doi: 10.1055/s-0045-1810915)
„Früherkennung bleibt der Dreh- und Angelpunkt – gerade auch bei jüngeren Patientinnen und Patienten. Die präsentierten Daten sprechen dafür, Therapieentscheidungen noch konsequenter zu individualisieren, insbesondere im höheren Lebensalter. Gleichzeitig gilt: Die MSI/MMR-Diagnostik weist bereits heute den Weg zu potenziell vielversprechenden Immuntherapie-Strategien; für einen routinemäßigen Einsatz braucht es jedoch weitere, robuste Evidenz – idealerweise aus größeren, prospektiven (randomisiert-kontrollierten) Studien“, kommentiert Dr. Lukas Welsch vom Vorstand der der JUGA und der Stiftung LebensBlicke.