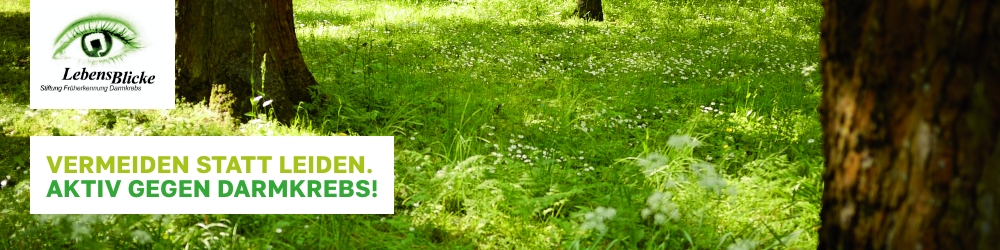Um die Frage „Darmkrebs bei jüngeren Menschen – eine reale Bedrohung?“ drehte sich am 21.01.2026 ein hochkarätig besetzter, online durchgeführter Experten-Workshop der Stiftung LebensBlicke. Unter der Moderation von Dr. Dietrich Hüppe und Prof. Christoph Eisenbach, beide Mitglieder des Vorstands der Stiftung, wurden zunächst die internationale Datenlage aus Europa und den USA (Prof. Cornelia Ulrich, Salt Lake City) sowie die aktuelle Situation in Deutschland (Prof. Alexander Katalinic, Lübeck, und Dr. Klaus Kraywinkel, RKI Berlin) beleuchtet. Prof. Hermann Brenner (DKFZ Heidelberg) ging der Frage nach, für wen, wie und wann ein Screening für Darmkrebs unter 50 Jahren sinnvoll sein könnte. Priv. Doz. Dr. Matthias Kelm (Würzburg) stellte die klinischen Besonderheiten von Karzinomen unter 50 Jahren vor, während Winfried Plötze (Stuttgart) zielgruppenspezifische Auswertungen des iFOBT der BARMER präsentierte. Weiterlesen